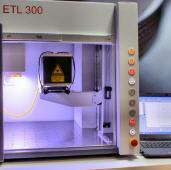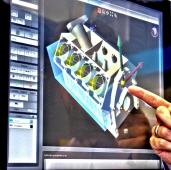Oberflächentechnik mit Anspruch
Spitzenforschung der TU-Clausthal
Die Oberflächentechnik ist ein wichtiger Techniktreiber. Ohne diesbezügliche Innovationen wären viele moderne Produkte undenkbar. Prof. Dr. Frank Endres von der TU Clausthal erläutert, welches Potenzial hier schlummert.

Prof. Dr. rer. nat. Frank Endres
Sehr geehrter Herr Prof. Endres, das Institut für Elektrochemie der TU Clausthal beschäftigt sich hauptsächlich mit der Erforschung ionischer Flüssigkeiten. Neue Batteriematerialien werden hier ebenso erprobt, wie neue Zink- beziehungsweise Aluminiumbeschichtungen für Stahl- oder Magnesiumlegierungen, die keine Wasserstoffversprödung kennen. Wo konnten Sie bisher die größten Erfolge feiern?
Prof. Frank Endres: Für einen Grundlagenforscher ist die Frage nach einem Erfolg nicht unbedingt einfach zu beantworten, da sich grundlegende Ergebnisse nicht selten erst nach vielen Jahren umsetzen lassen, falls überhaupt. In Karlsruhe und Clausthal waren wir sicher die ersten, die das Potential ionischer Flüssigkeiten in der Elektrochemie nutzten. Durch ihren außerordentlich geringen Dampfdruck können sie in der Ultrahochvakuumphysik untersucht werden, ihre weiten elektrochemischen Fenster erlauben die Abscheidung von Aluminium, etwa zum Korrosionsschutz von hochfesten Stählen. Einem meiner Mitarbeiter gelang kürzlich nahe Raumtemperatur die Synthese von Galliumantimonid. Dazu konnten wir zeigen, dass die hochkomplexen Grenzflächenschichten, die sich auf Festkörperoberflächen bilden, die Korngröße und Struktur von Depositen beeinflussen können.
Funktionale Oberflächen sind ein wichtiger Zukunftstrend in vielen Bereichen. Nicht zuletzt Umweltschutzauflagen haben dafür gesorgt, dass neue Verfahren entwickelt werden, den Grundwerkstoff zuverlässig vor Korrosion zu schützen. Was kommt diesbezüglich aus Ihren Labors und woran wird noch geforscht?
Prof. Endres: Die Auflagen der EU haben die Oberflächentechnik vor schwer zu lösende Probleme gestellt. Vollverzinkte Autos waren vor 15 Jahren ein Garant für Korrosionsfreiheit. Die Zinkschichten waren 10 – 20 µm dick. Heute sind die Zinkschichten nur noch circa 7 µm dick, und die EU hat die Verwendung von Chrom(VI)-Verbindungen faktisch verboten, sodass Neufahrzeuge heute manchmal schon nach drei Jahren Kantenrost zeigen. Wir können Aluminium haftfest auf verschiedenen Stählen abscheiden und diese so gut vor Korrosion schützen. Der Pferdefuß ist, dass die ionischen Flüssigkeiten recht teuer sind und Schutzgasbedingungen erfordern. Hier arbeiten wir aber an neuen Konzepten. In wenigen Jahren könnte die Abscheidung von Aluminium in getrockneter Luft möglich sein.
Edelstahl wird gebeizt, um die Oberfläche von Zunder, Eisenabrieb oder Anlauffarben zu befreien und die Ausbildung einer Passivschicht als Korrosionsschutz zu ermöglichen. Da hier Fluss-, Salpeter- oder Schwefelsäure verwendet wird, ist dieser Vorgang mit hohen Gesundheits- und Umweltrisiken verbunden. Haben Sie diesbezüglich etwas Besseres anzubieten?
Prof. Endres: Zunächst einmal habe ich keine Angst vor den genannten Säuren, denn werden diese nach den üblichen Sicherheitsvorschriften gehandhabt, ist das von ihnen ausgehende Risiko doch eher überschaubar. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis die EU auch solche Prozesse verbietet. Es gibt einige ionische Flüssigkeiten, die recht große Mengen an Metalloxiden lösen. Wir haben etwa eine Flüssigkeit, die bei 100 Grad Celsius bis zu 2,5 Mol/L Zinkoxid löst und mit Wasser gemischt werden kann.
Man müsste nun ausprobieren, inwieweit diese ionische Flüssigkeit auch den Zunder auf Eisenwerkstoffen entfernt. Würde dies gelingen, könnte man im anschließenden Schritt Zink oder Aluminium abscheiden und Prozesse entwickeln, die der deutschen Galvanik einen internationalen Vorsprung ermöglichen würden. Meist scheitern solche Ideen aber an den Kosten, und die Energiewendebedingte Strompreisexplosion ist für den Standort Deutschland sicher nicht unbedingt von Vorteil.
Wenn Bauteile hartverchromt werden, wird es nicht selten gleich komplett hartverchromt, selbst wenn nur eine kleine Lauffläche diesen Schutz benötigen würde. Es gibt nun am Markt Verfahren, diesen Vorgang selektiv vorzunehmen. Dadurch kann bestimmt werden, was beschichtet wird. Nachteilig ist, dass sechswertiges Chrom verwendet wird, das ab 2017 gemäß Reach nur mehr in absoluten Ausnahmefällen eingesetzt werden darf. Gibt es bereits jetzt Ersatz für diesen Stoff?
Prof. Endres: Jein. Mir persönlich ist nicht vollständig klar, warum die EU Chrom(VI)-Verbindungen faktisch verboten hat. Eine fachgerecht konstruierte Galvanikanlage für Cr(VI) würde kein Gesundheitsrisiko darstellen. Folge ich der Logik der EU, müssten mit sofortiger Wirkung Lithium-Ionen-Batterien verboten werden, denn bei deren Brand entstehen Flußsäure und Stäube aus Cobaltoxiden, letztere sind wiederum cancerogen. Die Politik entscheidet irgendwas, Forscher sollen die Lösung entwickeln, und wenn die Lösung dann nicht da ist, sind die Gesichter lang.
Wir sind aktuell an einem EU-Antrag beteiligt, bei dem die Entwicklung von alternativen Prozessen für Hartchrom angeschoben werden soll. Man könnte auch darüber nachdenken, Aluminium abzuscheiden und dieses mit einer Eloxalschicht aus Aluminiumoxid zu überziehen. Das ist aber nur eine Idee von vielen. Ich persönlich erwarte, dass die Hartverchromung nach 2017 außerhalb von Europa durchgeführt wird, oder man arrangiert sich eben mit den bis dahin entwickelten Prozessen.
Die Energiewende wird immer als besonders umweltfreundlich dargestellt. Nun geben jedoch die Opferanoden für die stählernen Fundamente der zahlreichen auf See installierten Windkraftanlagen giftige Metallverbindungen ans Wasser ab. Es ist die Rede von Tausenden Tonnen in den nächsten Jahren. Können Sie beurteilen, ob dieses Material eine Bedrohung für die Tierwelt darstellt und haben Sie eine Idee, wie man der Gefahr begegnen könnte?
Prof. Endres: Ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, dass die Politik hier sehr doppelzüngig ist. Diese Metallverbindungen werden sicher in der Nahrungskette auftauchen, eine Anreicherung und reale Gesundheitsgefährdung werden wir in den kommenden 10 bis 20 Jahren beurteilen können, denn nach den Plänen der Bundesregierung sollen offshore-Windkraftanlagen ja das Gerüst der Energiewende werden, sodass hier sicher noch viele Anlagen gebaut werden – falls Deutschland vorher nicht pleite ist.
Das US-Unternehmen ›Modumetal‹ hat ein Verfahren entwickelt, eine Metalllegierung an der Werkstückoberfläche zu bilden, indem es in ein chemisches Bad mit verschiedenen Metall-Ionen gelegt wird und es unter Strom setzt. Mit Hilfe dieses Stroms werden die Ionen angeregt, besagte Legierung zu bilden. In der Theorie war dieses Verfahren schon vor 45 Jahren in Deutschland unter dem Namen ›KONTEF‹ bekannt. Ein neuer Hinweis darauf, dass in Deutschland zwar wichtige Entdeckungen gemacht werden, den Nutzen jedoch nur Unternehmen im Ausland erkennen?
Prof. Endres: Ach, da gibt es doch unzählige weitere Beispiele. Man denke nur an die Magnetschwebebahn oder an Lithiumionen-Batterien. Nur wenigen Leuten dürfte bekannt sein, dass der leider viel zu früh verstorbene Kollege Jürgen Besenhard in den 1970er und 1980er Jahren in Deutschland viel beachtete grundlegende Arbeiten zur Chemie von Lithiumionenbatterien durchführte. Nach einem Zwischenhoch der Batterieforschung um 1990 und dem grandiosen Scheitern des ersten Elektroauto-Hypes hatte Deutschland nichts Besseres zu tun als die Batterieforschung und beinahe die gesamte Elektrochemie abzuwickeln.
Keine 20 Jahre später, um 2008, merkt man, dass man einen Fehler begangen hatte. Ich habe meine Zweifel, dass der jetzige Elektroauto-Hype ein Erfolg sein wird. Deutschland ist auch aus der Kernenergie ausgestiegen, deren Grundlagen in Deutschland gelegt wurden. Es ist zu befürchten, dass Deutschland den Rückstand später nicht mehr aufholen wird. Ein paar Elektrochemiker hat man schnell zusammengetrommelt, aber die Kernenergie in 20 Jahren ohne ausländische Hilfe wiederaufzubauen, halte ich für undenkbar. Daher wird es aus Deutschland vielleicht bald keine Innovationen mehr geben, die dann im Ausland vermarktet werden.
Die Natur ist ein wunderbarer Lehrmeister, wenn es um neue Materialien geht. Man denke nur an Spinnenseide, die jeden modernen Stahl alt aussehen lässt. Forscher haben nun herausgefunden, dass die Zähne der Napfschnecke die Spinnenseide als stärkstes biologisches Material sogar noch übertrumpfen. Das Zahnmaterial widerstand Kräften von rund 120 Gigapascal, bevor es brach. Verfolgen Sie auch eine Idee der Natur, um diese in technische Lösungen zu überführen?
Prof. Endres: Wir arbeiten zusammen mit dem Harbin Institute of Technology in Nord-China, wo ich invited professor bin, ein wenig an der elektrochemischen Synthese von photonischen Kristallen. Photonische Kristalle kennt man von Schmetterlingsflügeln und Opalen. Sie haben die interessante Eigenschaft, winkelabhängig Licht zurückzustreuen, was die Effizienz von Solarzellen verbessern könnte. Darüberhinaus sind invers-opale Strukturen, die wir templatgestützt herstellen können, recht interessante Batteriematerialien, da sie mit großer innerer Oberfläche die schnelle Interkalation/De-Interkalation von Lithium beispielsweise in Silizium erlauben. Wir kommen hier aber nur sehr langsam voran, da die Forschungsgelder an den stark besparten Universitäten für solche Ideen sehr begrenzt sind.
Quasikristalle sind bisher ins Reich der Fabel verwiesen worden. US-Forscher haben nun jedoch in einem rund 4,5 Milliarden Jahre alten Meteoriten nun genau diese Struktur aus Metallatomen entdeckt. Steckt in dieser Überraschung Potenzial für neue Materialien mit exotischen Eigenschaften?
Prof. Endres: Hier erwähnen sie ein Beispiel, das aus einem anderen Grunde sehr interessant ist. Als Dan Schechtman seine Ergebnisse zu Quasi-Kristallen vorstellte, war der damalige Vorsitzende der American Chemical Society (ACS) recht erzürnt und bezeichnete ihn als „Quasi-Wissenschaftler“. Heute lacht die ACS zwar darüber, aber man kann gut sehen, dass man niemals davon ausgehen sollte „The science is settled.“. Ein einziges reproduzierbares Experiment genügt, um solche „Mehrheitsmeinungen“ ad absurdum zu führen und auch einen Nobelpreisträger ziemlich alt ausschauen zu lassen, wenn auch posthum.
Aber selbst, wenn die Beweise auf der Hand liegen, werden alternative Meinungen bis zur Ächtung bekämpft, denn der ein oder andere, der sich der bequemen Mehrheit angeschlossen hat, kämpft dann schon mal um seinen Ruf. Ich habe mir im Laufe der Jahre eine gewisse Bescheidenheit angewöhnt und animiere Mitarbeiter/innen und Studierende, sich stets eine eigene Meinung zu bilden und auch mich in Frage zu stellen, denn ich weiß ganz gewiss nicht alles. Die Menschheit versteht die Ozeane, den Erdmantel und das Klimageschehen nicht, daher bin ich überzeugt, dass die Natur noch sehr viele Überraschungen für uns bereithalten wird. Quasikristalle sind zunächst vielleicht eher noch eine Kuriosität, aber wenn man die Synthesewege besser versteht, kann ich mir Werkstoffe, bei denen etwa die Härte eingestellt werden kann, durchaus vorstellen.
Phosphor ist, je nach Quelle, noch einige Jahrzehnte bis einige Jahrhunderte vorhanden. Es ist jedoch absehbar, dass dieses wichtige Düngemittel irgendwann nicht mehr in ausreichendem Maße gewonnen werden kann. Wäre es nicht denkbar, mit Nanotechnik behandelte Filterbleche einzusetzen, um diesen Stoff aus den Abwässern wieder herauszufiltern, um die Phosphorvorräte zu strecken?
Prof. Endres: Ich habe auch schon von dem Peak-Phosphor gehört, bin mir aber nicht ganz sicher, ob hier das nächste Angstszenario nach Waldsterben, BSE, Acrylamid und Klimakatastrophe aufgebaut wird, oder ob es sich um ein reales Problem handelt. Sicher ist, dass man Ammoniak als Düngerbasis mit Luft-Stickstoff leicht herstellen kann, Phosphor aber abgebaut werden muss und dessen Vorräte daher naturgemäß endlich sind. Ironischerweise enthalten natürliche Phosphate nennenswerte Mengen an Uran, was in der konventionellen Landwirtschaft jedoch nicht weiter beachtet wird. Ich will hier nicht weiter spekulieren, aber Phosphate könnte man aus den Abwasserströmen durchaus entfernen.
Wo sehen Sie Potenzial, künftig bessere Batterien zu bauen? Ist die Kombination Zink-Luft vielversprechend oder sollte eher auf die Lithium-Ionentechnik gesetzt werden?
Prof. Endres: Ich kann nicht einschätzen, in welche Richtung sich die Batterieforschung entwickeln wird. Lithium-Polymer-Batterien sind bezüglich der Leistungsdichte von bis zu 6 kW/kg sicher die leistungsfähigsten Batterien auf dem Markt. So ist es nicht verwunderlich, dass eine 50 kg schwere LiPo-Batterie kurzzeitig 300 kW (400 PS) leistet und so ein Hybridfahrzeug eine Weile elektrisch antreiben kann – wäre da nicht die geringe Energiedichte von maximal 0,3 kWh/kg, von denen heute nur 0,1 – 0,15 erreicht werden. Nach 30 – 50 km ist eine solche Batterie leer. Zink/Luft-Batterien erreichen als Primärzellen schon heute 0,3 kWh/kg, die Leistungsdichte ist aber viel geringer.
Beide Batterietypen unterliegen einer unvermeidbaren Alterung, zudem ist Lithium ein eher seltenes Metall. Es macht daher durchaus Sinn, LiPo-Batterien weiter zu entwickeln und insbesondere das Brandrisiko zu reduzieren. Für eine flächendeckende Elektromobilität halte ich keines der Systeme für geeignet, für die großtechnische Speicherung von „erneuerbarem“ Strom auch nicht unbedingt, da die Kosten durch die Decke schießen würden. Ich persönlich räume der Redox-Flow-Batterie mit natürlichen Substanzen in der Zukunft Chancen ein. Chinone/Hydrochinone sind pflanzliche Moleküle, die reduziert beziehungsweise oxidiert werden können. Damit kann man grundsätzlich eine Batterie herstellen, und zwar mit nachwachsenden Rohstoffen.
Es handelt sich hier aber um Zukunftsmusik. Andere interessante Batterietypen könnten Zink- oder Aluminiumionen-Batterien sein. Gerade Aluminium ist mehr als ausreichend vorhanden, und verwendet man für die andere Elektrode natürliche Materialien oder welche die auf Kohlenstoff basieren, könnte man interessante künftige Konzepte angehen. Leider gibt es für solche Ideen viel zu wenig Forschungsgelder, und bei der letzten BMBF-Ausschreibung ›Batterie 2020‹ wurden wohl ausschließlich Konzepte zu Lithiumionen-Batterien gefördert. Insgesamt wurden wohl 80 Prozent der Anträge (auch unserer zu Zink/Luft-Akkus) abgelehnt.
Wird die Batterietechnik in absehbarer Zeit je in der Lage sein, als vollwertiger Energiespeicher E-Autos nicht nur anzutreiben, sondern auch mit allem Komfort, wie etwa Innenraum- oder Sitzheizung selbst bei extremen Minusgraden zu nutzen?
Prof. Endres: Das erwarte ich nicht. Rechnen wir doch einmal: Angenommen, wir wollen mit einem Auto der Golf-Klasse eine Strecke von 500 km zurücklegen. Solche Strecken kommen häufiger vor als uns Politiker erzählen. Nehmen wir ferner an, dieses Auto benötigt für 100 km Fahrtstrecke im Sommer 15 kWh (das wäre auf einen „Benziner“ umgerechnet circa 1,5 Liter Benzin pro 100 km). Für eine Reichweite von 500 km benötigen wir dann eine Batterie mit einem Energieinhalt von 75 kWh. Gehen wir mal davon aus, dass bald eine Energiedichte von 0,2 kWh/kg erreicht wird, würde die Batterie dieses Fahrzeugs alleine schon 375 kg wiegen. Kürzlich stellte eine amerikanische Firma eine Speicherbatterie vor, die nur 300 EUR/kWh kosten soll.
Rechnen wir mal mit sehr optimistischen 200 EUR/kWh. Diese 75 kWh Batterie würde dann alleine circa 15 000 EUR kosten und vielleicht acht Jahre nutzbar sein. Nach acht Jahren kann man dann ein ehemals 50 000 Euro teures Fahrzeug entweder entsorgen oder eine neue Batterie einbauen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Reichweite im Winter, wenn der Innenraum geheizt wird, auf vielleicht 200 km sinken würde. Nun könnte man argumentieren, dass sich die Schnellladung von Batterien weiter verbessert. Das ist sicher richtig, nur altern Batterien umso schneller, je schneller man sie auflädt, und wie ein Stromnetz mit diesen Lasten bei Fortschreiten der „Energiewende“ umgehen soll, weiß ich nicht.
Wie sieht es hinsichtlich der Energiewende aus? Sind Batteriespeicher realistisch, die die von Solarzellen und Windrädern produzierte Energie bis zum Abrufen wirtschaftlich speichern oder rechnet sich so etwas nie?
Prof. Endres: Auch da können wir rechnen. Im Endziel der Energiewende soll der Strom in Deutschland alleine aus erneuerbaren Quellen kommen, im Wesentlichen wohl aus Windkraftanlagen. Schaut man sich die Daten der letzten Jahre an, sieht man, dass im Winter durchaus schon mal ein paar Wochen der Wind nicht weht. Die Schätzungen für den Speicherbedarf variieren zwischen optimistischen 20 TWh und 100 TWh. Deutschland hat einen jährlichen Strombedarf von 600 TWh, wovon alleine die Industrie circa 450 TWh benötigt.
Ich rechne gerne mit 50 TWh Speicherbedarf, für die ich aus Energiewende-Kreisen schon kritisiert wurde, manche sagen ja, dass man keine Speicher brauche, wenn es erst einmal genügend Windkraftanlagen gibt. Na ja, die ersten europäischen Einspeisedaten zeigen unmissverständlich, dass die Leistung aller WKA hochgradig korreliert ist und eben nicht jede Anlage stochastisch einspeist, zudem gibt es im Winter kaum Ertrag aus der Photovoltaik. Ich rechne daher mit 50 TWh. Gehen wir mal davon aus, dass die Anschaffung von 1 kWh Speicher Kapitalkosten von 100 EUR verursacht, die alle zehn Jahre wiederkehren. Die Speicherung von 50 TWh würde bei Batterien Anschaffungskosten von fünf Billionen Euro alle zehn Jahre verursachen, pro Jahr demnach 500 Milliarden Euro.
Rechnet man diesen jährlich anfallenden Betrag auf 600 TWh um, würde alleine ein Speicherpreis von rund 1 EUR/kWh resultieren, wenn man dazu noch Rückstellungen berücksichtigt. Bis zum Jahr 2020 wird der Netzausbau und die steigende Zahl der Windkraftanlagen nach Berechnungen von NAEB zu einem Strompreis von 45 Ct/kWh führen. Daraus kann man abschätzen, dass sich selbst in einem sehr günstigen Szenario der Strompreis in die Richtung 2 EUR/kWh bewegen wird.
Da die meisten anderen Länder auf Kohle- und/oder Kernenergie setzen, würde Deutschland in diesem Szenario nur noch ein verspargelter Fleck auf der Landkarte sein. Speicherpreise von 2 – 3 Ct/kWh, die Lobby-Verbände verbreiten, beziehen sich auf die zyklische Alterung von Batterien in einem Netz, das maximal eine Minutenreserve benötigt. Das sind unrealistische Annahmen. Wie viel Schaden wird angerichtet sein, bis die Erkenntnis reift, dass eine 100%-ige Versorgung mit „Erneuerbaren“ in der internationalen Konkurrenz wirtschaftlich nicht möglich ist?
Ergeben Ihre Forschungen Anzeichen, dass es möglich sein könnte, Elektromotoren aus anderen Materialien als Kupfer zu bauen, da dieses Material teuer und schwer ist? Wären demnach Motoren denkbar, die leistungsstärker, leichter und in der Herstellung billiger wären?
Prof. Endres: Nun gut, Kupfer hat natürlich einige unschlagbare Vorteile: Es ist relativ edel, ferner hat es eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit. Dazu kommt, dass es sich sehr gut wickeln und isolieren lässt. Eine Alternative zu finden, wird nicht so ganz einfach sein. Man könnte aber durchaus an Aluminium und Aluminium-Kupfer-Legierungen denken. Aluminium ist ein häufiges Element mit hoher thermischer und elektronischer Leitfähigkeit, es hat nur die Nachteile, dass für seine Herstellung recht viel Energie nötig ist und es aufgrund seiner Spannungslage korrosionsempfindlich ist, dazu recht weich. Wir können grundsätzlich jedoch Aluminiumschrotte mit wenig Energieaufwand elektrochemisch in Reinst-Aluminium umwandeln. Solche Wege werden sicher aber erst dann beschritten, wenn der Preis von Kupfer durch die Decke schießt.
Das Recycling von Metall ist überhaupt ein Bereich mit sehr großer Zukunft. Allerdings wird dafür viel Energie benötigt. Wird durch die extrem hohen Strompreise in Deutschland nicht verhindert, dass künftig noch mehr Recycelt wird beziehungsweise neue Technik mit noch mehr Potenzial das Licht des Schrottmarkts erblickt?
Prof. Endres: Das ist eine schwierige Frage. Recycling hat sicher enormes Potential. Manchmal scheitern gute Ideen aber an dem Willen der Industrie. Wir konnten zeigen, dass aus einigen Tantalkondensatoren die metallischen Anteile rückgewonnen werden können und stellten die Idee einer Firma vor. Dort wurde unmissverständlich gesagt, dass unser Verfahren niemals in eine Anwendung fließen wird. Der „Chef-Wissenschaftler“ sagte noch, er finde die Idee gut, und sollte etwas dabei herauskommen, wolle er der erste sein, der davon erfahre. Solche Denkmuster muss ich wohl nicht unbedingt verstehen. Die nicht wirtschaftlich verwertbaren Tantalreste werden daher weiterhin in Schlacken deponiert.
Es besteht also die Gefahr, dass aus Kostengründen wieder mehr teure Rohstoffe auf Deponien verfrachtet werden?
Prof. Endres: Das ist schwer zu sagen, zumindest aber im Falle von Tantal deponiert man die nicht wirtschaftlich gewinnbaren Metalle wohl lieber auf Deponien als sie zu recyclieren oder zumindest Forschungsansätze zu fördern. Da solche Ideen in Deutschland faktisch nur mit Industriebeteiligung gefördert werden können, kommen wir in dieser Fragestellung eben nicht weiter. Allerdings weiß ich aus meiner Gutachtertätigkeit, dass im Ausland an solchen und ähnlichen Konzepten geforscht wird.
Sie beschäftigen sich auch mit der Möglichkeit, die Standzeit der Schweißelektroden von Punktscheißgeräten zu verlängern. Gibt es schon Erkenntnisse aus der Forschung beziehungsweise welche Standzeit streben Sie für die nächste Generation von Schweißelektroden an?
Prof. Endres: Da haben Sie aber gut auf der website der TU Clausthal recherchiert. In der Tat wurde bei uns eine Masterarbeit ausgeschrieben, bei der die Standzeit von einigen Schweißelektroden verbessert werden soll. Ich möchte hier nun keine Details verraten, aber beschichtet man einige spezielle Elektroden an der richtigen Stelle mit Aluminium, kann sich die Standzeit dieser Schweißelektroden verbessern. Zunächst ist das Grundlagenforschung.
Gestatten Sie einen Blick in die Zukunft. Mit welchen Innovationen ist künftig aus Ihren Labors zu rechnen?
Prof. Endres: Wir werden uns weiterhin mit der Elektrochemie in ionischen Flüssigkeiten beschäftigen. Ich hoffe, dass wir zusammen mit Partnern die Aluminium-Elektrochemie vorantreiben können, denn neuere Entwicklungen haben durchaus das Potential, eine Aluminium-Galvanik unter atmosphärischen Bedingungen zu erlauben. Wir werden weiter an Batteriematerialien arbeiten und uns ungewöhnliche Systeme wie Aluminium/Luft und Silizium/Luft genauer anschauen. Dazu kommt die elementare Grundlagenforschung, und mich persönlich interessiert, mit welchem Mechanismus ionische Flüssigkeiten die Materialsynthese beeinflussen.
Herr Prof. Endres, vielen Dank für das Interview.
Download:
Diesen Artikel können Sie hier im PDF-Format herunterladen [153 KB] .
Mehr Informationen:
 |
Technische Universität Clausthal |
 |
Adolph-Roemer-Straße 2a |
 |
38678 Clausthal-Zellerfeld |
 |
|
 |
Institut für Elektrochemie |
 |
Gebäude C9 |
 |
Arnold-Sommerfeld-Straße 6 |
 |
Tel: +49 (0) 5323 72 2980 (Sekretariat) |
 |
Fax: +49 (0) 5323 72 2460 |
 |
E-Mail: frank.endres@tu-clausthal.de |
 |
www.iec.tu-clausthal.de |
War dieser Artikel für Sie hilfreich?
 |
 |
 |
 |
 |
Bitte bewerten Sie diese Seite durch Klick auf die Symbole.
Zugriffe heute: 3 - gesamt: 13211.